Ausgleichsanspruch: Pflege, Mitarbeit & besondere Leistungen

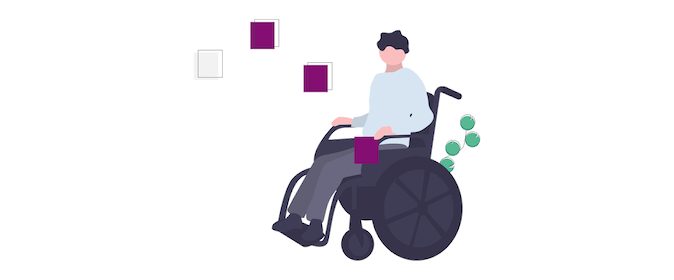
Erbrechtlicher Ausgleichsanspruch
- Erhalten Sie Einblick in den Ausgleichsanspruch: Erfahren Sie, warum besondere Leistungen eines Abkömmlings im Erbfall mehr als nur gewürdigt werden sollen. Dieser Ausgleichsanspruch sorgt dafür, dass Ihre aufwendige Pflege oder finanzielle Unterstützung beim Erblasser nicht einfach unter den Tisch fällt.
- Verstehen Sie den Unterschied zwischen Ausgleichsanspruch und Ausgleichungspflicht: Lernen Sie, wann Sie Ihre Leistungen geltend machen können und wann stattdessen Zuwendungen aus Lebzeiten auf Ihr Erbe angerechnet werden müssen. So behalten Sie den Überblick über Ihre Rechte und Pflichten im Erbrecht.
- Profitieren Sie bei der Erbauseinandersetzung: Entdecken Sie, wie sich der Ausgleichsanspruch konkret auf die Verteilung des Nachlasses auswirkt. Mit diesem Wissen vermeiden Sie Streitigkeiten in der Erbengemeinschaft und sichern sich Ihren gerechten Anteil vorab.
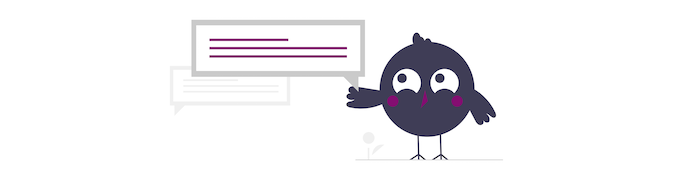
HEREDITAS KI-Agent
- Auswertung aller Inhalte meiner Webseite mittels KI. Stellen Sie Ihre Frage und erhalten Sie eine individuelle Antwort!
- Auch wenn die Antwort des KI-Agenten so formuliert sein könnte, stellt Sie keine Rechtsberatung für Ihren Einzelfall dar. KI-Ergebnisse können fehlerhaft sein. Alle Angaben ohne Gewähr.
- Ihre Eingaben werden entsprechend meiner Datenschutzerklärung verarbeitet.
Unterscheidung im Erbrecht: Ausgleichsanspruch vs. Ausgleichungspflicht
Ein Ausgleichsanspruch steht einem Abkömmling des Erblassers immer dann zu, wenn er durch besondere Leistungen dazu beigetragen hat, das Vermögen des Erblassers zu erhalten oder zu vermehren, ohne dafür ein (angemessenes) Entgelt bekommen zu haben, § 2057a BGB. Dem Willen des Gesetzgebers nach sollen diese Leistungen im Rahmen der Auseinandersetzung zwischen gesetzlichen Erben Berücksichtigung finden.
Der Ausgleichsanspruch ist insbesondere abzugrenzen von der sog. Ausgleichungspflicht. Bei jener geht es darum, dass ein Abkömmling zu Lebzeiten Zuwendungen vom Erblasser erhält, die auf sein gesetzliches Erbrecht angerechnet werden sollen. Regelmäßig handelt es sich hierbei um eine Ausstattung oder Zuschüsse, die als Einkünfte dienen sollen. Hier geht der Gesetzgeber davon aus, dass im Fall der gesetzlichen Erbfolge alle Abkömmlinge gleich behandelt werden sollen, unabhängig davon ob die Zuwendung im Wege der Erbfolge oder noch zu Lebzeiten erfolgt ist. Entsprechend muss der Empfänger sich diese Empfänge auf seinen Auseinandersetzungsanspruch anrechnen lassen, mithin also genau das Gegenteil der hier thematisierten Regelung. Lesen Sie hierzu meine Ausführungen zur Ausgleichungspflicht von Vorempfängen.
Wann erhält der Abkömmling einen Ausgleich von den Miterben?
Das Ausgleichsrecht besteht nur unter Abkömmlingen, wenn sie als gesetzliche Erben eingesetzt sind oder wenn sie zwar durch Testament eingesetzt sind, diese Einsetzung aber der gesetzlichen Erbfolge entspricht. Abkömmlinge sind neben den Kindern auch Enkel usw. und Adoptivkinder.
Ein Ausgleichsanspruch entsteht immer dann, wenn der Abkömmling in besonderem Maße dazu beigetragen hat, das Vermögen des Erblassers zu erhalten oder zu vermehren, § 2057a (1) BGB. Hierfür kommen 4 Fälle in Betracht:
- Mitarbeit im Haushalt: Langfristige Unterstützung des Erblassers z.B. durch Waschen, Kochen oder Putzen
- Unterstützung beim Beruf: Hierbei kann es sich entweder um unmittelbare Mitarbeit im Betrieb handeln (z.B. Buchführung) oder um allgemeine Unterstützungshandlungen im Zusammenhang mit dem Beruf
- Geldleistungen: Gemessen an den Vermögensverhältnissen des Erblassers können „erhebliche“ Geld- oder geldwerte Leistungen, die zur Erhaltung oder Vermehrung des Vermögens beim Erblasser geführt haben, zu einem Ausgleichsanspruch führen. Beispiele hierfür sind die Tilgung eines Darlehens oder die Stellung einer Bürgschaft
- Pflege des Erblassers: der häufigste Anwendungsfall. Ein Abkömmling pflegt über längere Zeit hinweg den Erblasser. Ob der Abkömmling dafür auf eigenes Einkommen verzichtet, also z.B. seine Arbeit aufgibt, ist nicht mehr relevant.
All diese Mitarbeiten führen aber nur dann zu einem Ausgleichsanspruch, wenn sie in besonderem(!) Maße dazu beigetragen haben, das Vermögen des Erblassers zu erhalten oder zu mehren. Alltagssituationen sollen gerade keine Ansprüche begründen.
Ein Anspruch ist auch immer dann ausgeschlossen, wenn der Abkömmling ein angemessenes Entgelt oder eine andere angemessene Gegenleistung vom Erblasser erhalten hat. Denn dann besteht genau die ausgleichsbegründende Intention nicht mehr: der Nachlass hat einen höheren Wert, weil Leistungen „nicht bezahlt“ wurden. Die Höhe des Ausgleichsanspruchs bestimmt sich nach Billigkeit, d.h. Dauer und Umfang der Leistungen sowie insbesondere der Wert des Nachlasses sind zu berücksichtigen. Ein fester Marktpreis hingegen wird gerade nicht angesetzt.
Sie haben ein rechtliches Anliegen zum Erben und Vererben?*

- Soforthilfe bei Rechtsfragen: Ihre Situation, Chancen und Risiken
- Beratung durch erfahrene Anwälte & Rechtsexperten
- Ortsunabhängig, einfach und digital
Wie erfolgt der Ausgleich in der Erbengemeinschaft?
Die Durchführung des Ausgleichs ist in § 2057a (4) BGB geregelt: hierzu wird zunächst der auszugleichende Betrag vom Nachlasswert abgezogen. Vom übrigbleibenden Betrag werden nun die jeweiligen Erbteile berechnet. Dem ausgleichsberechtigten Abkömmling wird im Anschluss sein Ausgleichsbetrag hinzugerechnet. Anhand dieser Werte erfolgt die Erbauseinandersetzung.
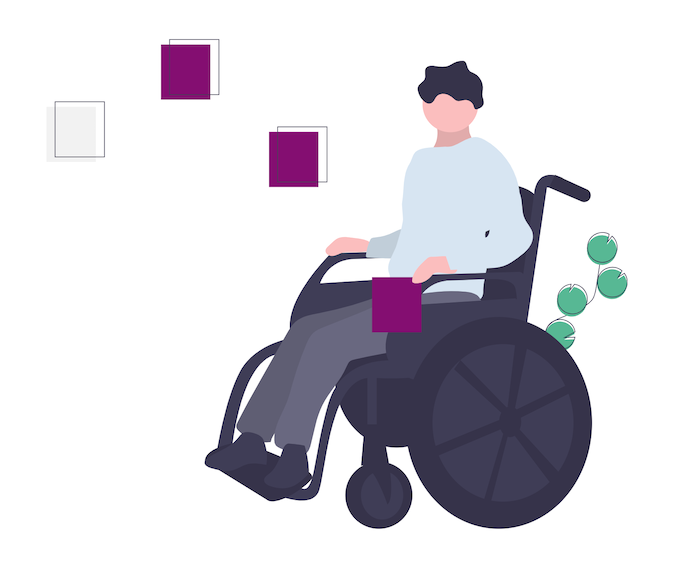
Fazit
Der Ausgleichsanspruch dient dazu, Vermögensmehrungen beim Erblasser, die auf besondere „geldwerte“ Leistungen eines Abkömmlings zurückzuführen sind, insbesondere weil dieser seine Leistungen unentgeltlich erbracht hat, nicht der gesamten Erbengemeinschaft zugute kommen zu lassen. Vielmehr soll dieser Abkömmling für seine besonderen Leistungen einen angemessenen Ausgleich vorab erhalten. Im Anschluss wird dann nur noch der reduzierte Nachlass im Rahmen der Auseinandersetzung verteilt.
 Erbrechtlicher Ausgleichsanspruch: Meine weiteren Artikel
Erbrechtlicher Ausgleichsanspruch: Meine weiteren Artikel
 Erbe ausschlagen: Gründe, Rechtsfolgen, Form und FristenAutor: Dr. Stephan Seitz
Erbe ausschlagen: Gründe, Rechtsfolgen, Form und FristenAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 16. Oktober 2024 Ausschluss Erbe: Enterbung, Erbverzicht & PflichtteilAutor: Dr. Stephan Seitz
Ausschluss Erbe: Enterbung, Erbverzicht & PflichtteilAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 16. Oktober 2024 Erbschein beantragen: Notwendigkeit, Vorgehen und KostenAutor: Dr. Stephan Seitz
Erbschein beantragen: Notwendigkeit, Vorgehen und KostenAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 15. Oktober 2024 Erbvertrag: Vertragliche Bindung auf den TodesfallAutor: Dr. Stephan Seitz
Erbvertrag: Vertragliche Bindung auf den TodesfallAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 15. Oktober 2024 Erbverzicht: Warum, wie und welche FolgenAutor: Dr. Stephan Seitz
Erbverzicht: Warum, wie und welche FolgenAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 16. Oktober 2024 Erbrecht: Praxiswissen für Miterben einer ErbengemeinschaftAutor: Dr. Stephan Seitz
Erbrecht: Praxiswissen für Miterben einer ErbengemeinschaftAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 15. Oktober 2024

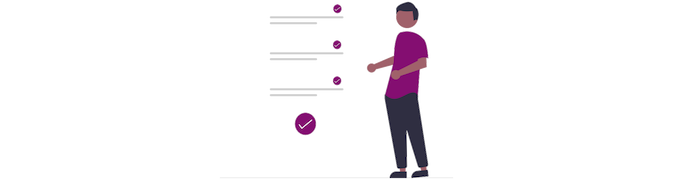
Kommentare
Sehr geehrter Herr Dr. Seitz,
28. März 2025 um 08:44 Uhr
darf eine Erbengemeinschaft einvernehmlich ein Mitglied der Erbengemeinschaft bestimmen, der die gesamte Verwaltung übernimmt und darf die Erbengemeinschaft ihn dafür bezahlen?
darf die Erbengemeinschaft einvernehmlich ein Mitglied der Erbengemeinschaft bestimmen, welche das Nachlassverzeichnis erstellt und es dafür bezahlen?
Beste Grüße
Silvia Z.
Dr. Stephan Seitz Autor
28. März 2025 um 08:44 Uhr
Liebe Silvia, grundsätzlich kann eine Erbengemeinschaft einvernehmlich ein Mitglied bestimmen, das die gesamte Verwaltung des Nachlasses übernimmt. Dies ist eine individuelle vertragliche Regelung, die die Miterben untereinander treffen können. In einem solchen Fall kann das bestimmte Mitglied auch eine Vergütung für seine Verwaltungsaufgaben erhalten. Ebenso kann die Erbengemeinschaft einvernehmlich ein Mitglied bestimmen, das das Nachlassverzeichnis erstellt. Auch hierfür kann eine Vergütung vereinbart werden, sofern alle Miterben damit einverstanden sind. Dies ist Ausdruck der Entscheidungsfreiheit der Miterben. Solche Regelungen schaffen Klarheit und können potenzielle Konflikte innerhalb der Erbengemeinschaft vermeiden. Gegebenenfalls muss die Vergütung versteuert werden. Ob es in Ihrem konkreten Fall gegebenenfalls abweichende Einzelfallumstände gibt, müssten Sie bitte mit einem Rechtsanwalt besprechen. Ich kann Ihnen nur allgemein zum Thema etwas sagen. Viele Grüße, Stephan Seitz
Anja Bulett
31. März 2025 um 18:26 Uhr
Ich werde über Art und Umfang des Nachlasses meiner Mutter im Unklaren gehalten. Ein Nachlassverzeichnis von der den Nachlass betreuenden Schwester erhalte ich trotz vielfacher, auch schriftlich vorgtragener Bitte nicht. Muss ich nun ein Nachlassverzeichnis einklagen. Wie werden hierfür die Kosten sein?
Beste Grüße
Anja
Dr. Stephan Seitz Autor
31. März 2025 um 18:26 Uhr
Liebe Anja, als Miterbe haben Sie verschiedene Auskunftsrechte, um sich einen Überblick über den Nachlass zu verschaffen. Diese Rechte sind entscheidend, um Ihren Erbteil souverän durchzusetzen und Streitigkeiten zu vermeiden. Hier sind einige der wesentlichen Auskunftsrechte:
1. Auskunftsanspruch nach § 242 BGB (Treu und Glauben): Wenn ein Miterbe über exklusives Wissen verfügt, das ein anderer Erbe vernünftigerweise nicht selbst beschaffen kann, kann ein allgemeiner Auskunftsanspruch bestehen.
2. Rechenschaftspflicht bei Vollmacht (§ 666 BGB): Wenn ein Miterbe zu Lebzeiten des Erblassers dessen Angelegenheiten geregelt hat, kann er auskunfts- und rechenschaftspflichtig sein.
3. Erbschaftsbesitzer (§ 2027 BGB): Wer etwas aus der Erbschaft an sich nimmt, ohne tatsächlich Alleineigentum zu haben, ist den Miterben gegenüber auskunftspflichtig.
4. Hausgenosse (§ 2028 BGB): Wohnte ein Miterbe mit dem Erblasser in häuslicher Gemeinschaft, muss er über alle erbschaftsrelevanten Umstände Auskunft geben.
5. Ausgleichspflichtige Zuwendungen (§§ 2050 ff. BGB): Hat ein Miterbe bereits zu Lebzeiten Zuwendungen vom Erblasser erhalten, kann dies bei der Erbteilung angerechnet werden, und der Miterbe muss darüber Auskunft geben.
Ggf. genügt es, wenn Sie Ihrer Schwester die rechtliche Lage darlegen. Am Ende hilft natürlich nur eine Klage, wenn es keine einvernehmlichen Weg gibt.
Schreiben Sie Ihren Kommentar!